Migration gab es schon immer...
ein Projekt im Rahmen des Europäischen Wettbewerbs

ein Projekt im Rahmen des Europäischen Wettbewerbs
Wir, Constanze und Paul, sind Schüler am Städtischen Gymnasium in Hennef. Im Rahmen unseres Differenzierungsfachs EGS (European and Global Studies) nehmen wir mit unserem Projekt am Europäischen Wettbewerb im Modul „Migration überschreitet Grenzen“ teil.
Ziel in diesem Modul ist es, sichtbar zu machen, wie Europäerinnen und Europäer auf ihrem Weg in andere Länder, Grenzen und andere Kulturen überwinden mussten.
Immer heftiger wird in Deutschland und Europa darüber diskutiert, wie viele Menschen in Europa ihren Platz finden dürfen, welche Gründe dafür vorzubringen sind. Wirtschaftliche Gründe beispielsweise werden meistens aufs Heftigste abgelehnt - insbesondere von konservativen und rechten Parteien.
Dabei gab es Migration schon immer; durch die gesamte Menschheitsgeschichte migrierten die Menschen aus den vielfältigsten Gründen. Aber die wirtschaftliche Situation ist einer der Hauptgründe. Auch Hungersnöte lösten beispielsweise riesige Migrationswellen in andere Länder aus.
Unsere Idee bei diesem Projekt ist, die analoge und digitale Welt zu verbinden. Die historische Migration aus Europa machen wir sichtbar, indem wir einen Globus mit Migrationsrouten gestaltet haben; über QR-Codes an diesen Routen ist diese Seite hier mit weiteren Informationen verlinkt.

Da europäische Länder vor gar nicht langer Zeit keine Einwanderungs-, sondern Auswanderungsländer waren, gibt es sehr viele Beispiele, wie sehr große Auswanderungsbewegungen in andere Erdteile stattfanden. Wir haben uns auf drei Beispiele konzentriert, um diese Migrationsbewegungen darzustellen. Auch wenn wir damit nur einen kleinen Teil der Migrationsrouten aus Europa darstellen, zeigt es doch deutlich, dass wir Europäer für andere Länder in der Vergangenheit auch „Wirtschaftsflüchtlinge“ waren.
Migration im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts bestand zum Großteil aus Soldaten europäischer Nationen, das hängt mit der Kolonialisierung von Australien, Nord- und Südamerikas zusammen. Viele Personen, die die Kolonien etablierten, blieben dort. In den folgenden Jahren überwog, wie das nachstehende Beispiel 1 zeigt, die Migration aus wirtschaftlichen Gründen. Deshalb haben beispielsweise in den USA sehr viele Einwohner europäische Wurzeln und es entwickelte sich zunächst eine ähnliche Kultur wie in Europa. Beispiele für erfolgreiche Migration gibt es viele, so z.B. den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger (1923-2023), welcher in Fürth geboren wurde sowie den österreichischen Schauspieler und Bodybuilder Arnold Schwarzenegger, der von 2003-2011 der 38. Gouverneur Kalifornien war.
Auch heute noch emmigrieren regelmäßig Menschen aus Europa; im Vergleich zu Migrationsrouten - ob nun historisch oder modern - eher im Verborgenen, wenn nicht gerade eine Fernsehsendung Einzelfälle thematisiert und in den Fokus stellt.
Das statistische Bundesamt teilt am 27.07.2023 mit, dass im Jahr 2022 der Wanderungsverlust deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gegenüber dem Ausland 83 000 Personen betrug und und damit höher ausfiel als im Jahr 2021 (64 000 Personen). Die deutschen Auswanderer waren nach den Ausführungen des statistischen Bundesamtes mehrheitlich männlich (60 %) und vergleichsweise jung mit durchschnittlich 35,0 Jahren im Vergleich zur deutschen Gesamtbevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 45,9 Jahren. Hauptzielländer waren wie auch in den Vorjahren die Schweiz, Österreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Jahr 2022 wurden 20 000 Fortzüge von Deutschen in die Schweiz, 12 000 nach Österreich und 10 000 in die USA registriert. Auch wenn es sich hier eher um Einzelfälle handeln dürfte, lassen sich die Zahlen erahnen, dass es sich auch hier um „Wirtschaftmigranten“ handeln dürfte. Deutschland wird auch weiterhin im Kleinen verlassen, um in anderen Ländern -auch außerhalb von Europa- „das Glück zu suchen“ oder aus anderen wirtschaftlichen Gründen, wie z.B. Steuervorteilen. Das gilt sicherlich auch für andere europäische Länder.
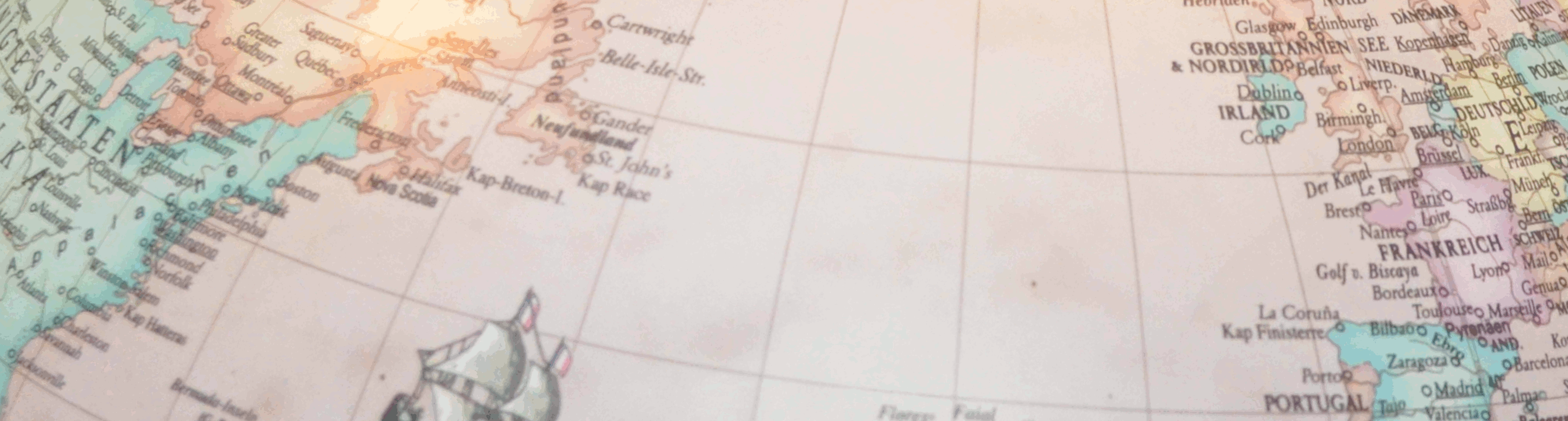 Erst seit den letzten Jahrzehnten ist Irland aufgrund von einem wirtschaftlichen Aufschwung zu einem Einwanderungsland geworden. Zuvor war es zum Großteil ein Auswanderungsland.
Erst seit den letzten Jahrzehnten ist Irland aufgrund von einem wirtschaftlichen Aufschwung zu einem Einwanderungsland geworden. Zuvor war es zum Großteil ein Auswanderungsland.
Schon vor 1800 begann in Irland die Auswanderung nach Nordamerika. Hierbei waren es zu Beginn oft religiöse Gründe, die irische Katholiken, Quäker oder Presbyterianer dazu brachten, Irland zu verlassen.
Der Höhepunkt der Auswanderung aus Irland fand jedoch erst 1847 statt und wurde durch die große Hungersnot (bekannt als Great Famine) ausgelöst.
Zu dieser Zeit arbeiteten über 70% der irischen Bevölkerung in der Landwirtschaft, dabei lebten sie auf kleinen bis sehr kleinen Bauernhöfen, wobei viele dieser Höfe für eine Existenzgrundlage zu klein waren. Arbeit außerhalb der Landwirtschaft war jedoch kaum vorhanden.
Der Mangel an Land und Arbeitsplätzen nahm zu, als Irland einen rapiden Bevölkerungszuwachs erlebte. Eine Ursache dafür war der Kartoffelanbau, der die Möglichkeit gab, auch mit kleinen Landstücken eine Familie zumindest minimal zu ernähren. Zusätzlich war es damals üblich, sehr jung zu heiraten und viele Kinder zu bekommen.
Der Kartoffelanbau entwickelte sich zu einer, anfällig für Pflanzenkrankheiten, Monokultur. Aus diesem Grund gab es bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts erste Ernteausfälle und Hungersnöte. Zwischen 1816 und 1842 gab es ganze 14 Kartoffel-Missernten. 1842 brach in Nordamerika eine bis dahin unbekannte Pflanzenkrankheit, die Kartoffelfäule, aus, welche fast die gesamte Ernte vernichtete und schnell auf Europa übersprang. In der Erntezeit im Oktober 1845 war die irische Kartoffelernte fast vollständig durch diese Krankheit zerstört.
In den vorherigen Jahren 1841 bis 1844 emigrierten durchschnittlich ungefähr 50.000 Iren pro Jahr, diese Zahlen stiegen nach dem Ernteausfall 1845 zunächst jedoch nicht an, da die Menschen die Hoffnung hatten, dass die nächste Ernte wieder besser ausfallen würde. Nachdem auch 1846 keine Ernte eingeholt werden konnte, stieg die Zahl der Auswanderer sprunghaft an. Einige Großgrundbesitzer förderten und finanzierten die Ausreise ihrer Pächter, damit sie für deren Unterhalt nicht mehr aufkommen mussten. Zusätzlich soll es Jugendliche gegeben haben, die Straftaten begingen, um in Sträflingskolonien wie beispielsweise Australien deportiert zu werden.
Zwischen 1845 und 1855, also im Zeitraum kurz vor, während und unmittelbar nach der Great Famine, wanderten ungefähr 1,8 Millionen Iren in die USA aus. Die meisten von ihnen hatten daher einen viel ärmeren Hintergrund als die irischen Auswanderer zuvor. Die extremen Umstände während der Hungersnot trieben viele Menschen dazu an, Irland zu verlassen. Somit wanderten zwischen den Jahren 1850 und 1913 über 4,5 Millionen Iren aus. Auf dem heutigen Gebiet der Republik Irland lebten 1841 über 6,5 Millionen Menschen. Die Great Famine führte aufgrund von Auswanderungen und Todesfällen dazu, dass die Bevölkerung bis 1901 auf 3,25 Millionen Menschen zurück ging. Auch danach schrumpfte die Bevölkerung weiter, sodass 1961 mit 2.818.000 Menschen der niedrigste Bevölkerungsstand in der Geschichte Irlands erreicht war. Auch heute leben mit rund 5,14 Millionen Bewohner immer noch weniger Menschen in Irland, als im mittleren 19. Jahrhundert.
Die Mehrheit der irischen Auswanderer im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen nach Nordamerika.
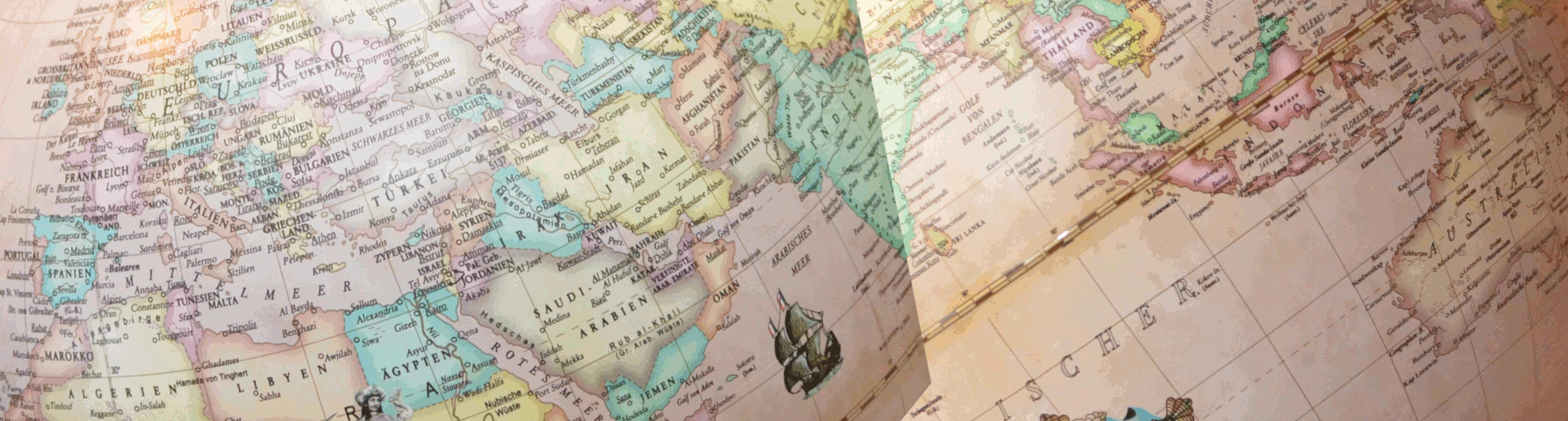 Im englischen Strafrecht wurde bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts die Todesstrafe für Hochverrat, Mord, Totschlag, Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung, Diebstahl, Urkundenfälschung und Falschmünzerei verhängt. Die Verschickung in Strafkolonien wurde als Ersatz für die Todesstrafe betrachtet.
Im englischen Strafrecht wurde bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts die Todesstrafe für Hochverrat, Mord, Totschlag, Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung, Diebstahl, Urkundenfälschung und Falschmünzerei verhängt. Die Verschickung in Strafkolonien wurde als Ersatz für die Todesstrafe betrachtet.
Am 6. Dezember 1786 wurde beschlossen, dass an der Ostküste Australiens ein Gefängnisort errichtet wird. Zuvor waren Verbrecher in die amerikanischen Kolonien zur Strafarbeit verbannt worden. Die Kapazitäten der Gefängnisse und die alternative Unterbringung in Gefängnisschiffen waren insbesondere nach dem Verlust der amerikanischen Kolonien erschöpft, um die zahlreichen Gefangenen aufzunehmen.
Zwischen den Jahren 1788 und 1868 kamen rund 163.000 britische und irische Sträflinge nach Australien. Weit entfernt von Großbritannien sollte zum einen die heimische Gesellschaft im Vereinigten Königreich entlastet werden, zusätzlich stellte dies billige Arbeitskräfte zur Verfügung, die für die Erschließung des australischen Territoriums genutzt werden konnten.
Ab den 1820er Jahren kamen auch zunehmend freie Siedler nach Australien. Rund 700.000 dieser Siedler, die zwischen 1820 und 1900 nach Australien migrierten, bekamen dabei eine staatliche Förderung.
Viele einflussreiche britische Menschen sprachen sich positiv gegenüber der Massenmigration nach Australien aus, einige von ihnen sahen darin auch den Schlüssel zu der Lösung der sozialen Frage im Vereinigten Königreich. Australien zählte zu einem der wichtigsten Ziele für britische Auswandernde und blieb dies auch noch nach dem Zerfall des Kolonialreichs.
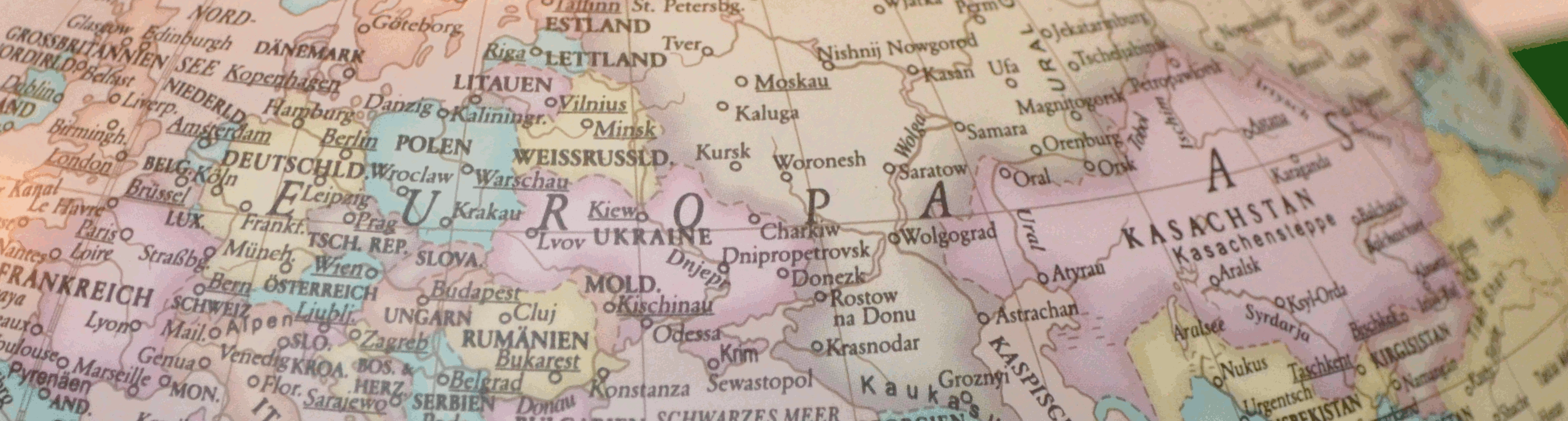 Auch Deutschland wurde Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein von vielen Menschen verlassen. Bis 1930 waren es ungefähr sechs Millionen Auswanderer. Gründe waren zum einen die schlechte wirtschaftliche Lage, zum anderen waren es auch religiöse und politische Motive. Die deutschen Auswanderer erhofften sich mehr religiöse Freiheit in der neuen Heimat oder hofften nach dem Scheitern der Revolution 1848 auf mehr demokratische Lebensverhältnisse in anderen Ländern. Die meisten gingen, ähnlich wie in Beispiel 1, nach Nordamerika, wo die Deutschen die zahlenmäßig größte Einwanderungsgruppe waren, noch vor den Menschen aus Irland. Die Iren hingegen stellten jedoch, gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl des Heimatlandes, den größten Bevölkerungsverlust des Herkunftslandes dar.
Auch Deutschland wurde Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein von vielen Menschen verlassen. Bis 1930 waren es ungefähr sechs Millionen Auswanderer. Gründe waren zum einen die schlechte wirtschaftliche Lage, zum anderen waren es auch religiöse und politische Motive. Die deutschen Auswanderer erhofften sich mehr religiöse Freiheit in der neuen Heimat oder hofften nach dem Scheitern der Revolution 1848 auf mehr demokratische Lebensverhältnisse in anderen Ländern. Die meisten gingen, ähnlich wie in Beispiel 1, nach Nordamerika, wo die Deutschen die zahlenmäßig größte Einwanderungsgruppe waren, noch vor den Menschen aus Irland. Die Iren hingegen stellten jedoch, gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl des Heimatlandes, den größten Bevölkerungsverlust des Herkunftslandes dar.
Noch zuvor, im 18. Jahrhundert, gab es eine Migrationswelle. Diese folgte anderen Gesetzmäßigkeiten. Dabei wurden Menschen gezielt von Russland für eine Auswanderung dorthin angeworben. Die Ansiedlungen erfolgten überwiegend im geographischen Europa, einige sind aber auch im asiatischem Raum einzuordnen.
Seit dem 15. Jahrhundert vergrößerte das russische Reich sein Staatsgebiet um das 52fache. Die Kolonisierung der eroberten, teils allerdings unbewohnten Territorien stellte jedoch jahrhundertelang eine anhaltende Herausforderung dar.
Katharina II., auch bekannt als Katharina die Große, wurde als Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst in Stettin, einer Stadt im damaligen Preußen und heutigen Polen, geboren. Sie war vom 9. Juli 1762 bis 1796 Kaiserin von Russland. Ähnlich wie Österreich und Preußen entschied sie sich dafür, eine Politik der „Peuplierung“, d.h. die planmäßige Besiedlung und Bewirtschaftung von unbewohnten und dünn besiedelten Gebieten durch zuverlässige neue Untertanten, umzusetzen.
1763 begann die Anwerbung von Siedlern mit dem „Kolonistenbrief“. Diese wurden vor allem im unteren Wolga- und Schwarzmeergebiet angesiedelt. Der Großteil dieser Kolonisten stammte aus deutschen Gebieten. Die gesamte Kolonisation mit ausländischen Bauern und Handwerkern verlief unter Kontrolle und auf Anweisungen der russischen Regierung. Somit bestimmten die Beamten auch die Standorte der künftigen Dörfer und erstellten Musterpläne für Siedlungen und einzelne Familienhöfe.
Die Kolonisten wurden in den russischen Untertanenverband aufgenommen, indem sie den russischen Treueeid ablegten. Allerdings wurde die Einwaderer von ihren russischen, ukrainischen und tatarischen Nachbarn abgegrenzt und einer staatlichen Sonderverwaltung unterstellt.
Die Einwanderer durften sich weiterhin der deutschen Sprache bedienen, somit erfolgte allerdings auch keine Integration, welches die Absicht des russischen Staates war. Sie befürchteten Einfluss des Protestantismus und Katholizismus auf orthodoxe Bauern und wollten dies vermeiden. Die Siedler wurden, aufgrund der nicht erfolgten Integration, nicht zu Russen, sondern blieben überwiegend deutsche Siedler, anders als dies in Nordamerika der Fall war. Dort wurden die Einwanderer nach ein oder zwei Generationen integriert, auch wenn sie häufig in einem der Heimat entsprechenden Umfeld lebten.